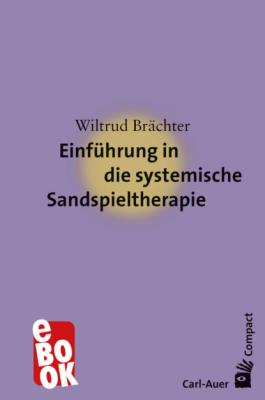ТОП просматриваемых книг сайта:
Einführung in die systemische Sandspieltherapie. Wiltrud Brächter
Читать онлайн.Название Einführung in die systemische Sandspieltherapie
Год выпуска 0
isbn 9783849783747
Автор произведения Wiltrud Brächter
Жанр Документальная литература
Серия Carl-Auer Compact
Издательство Bookwire
Der dialogische, im Verzicht auf Deutungen systemischen Konzepten weit vorausgreifende Ansatz Lowenfelds wurde anschließend nur wenig rezipiert. Bekannter wurde Sandspieltherapie durch Dora Kalff, die das Sandspiel in den 1950er-Jahren mit Theorien Jungs und Elementen des Zen-Buddhismus verband (Kalff 1966, 1979). Kalff betonte die heilsame Rückwirkung, die von den Sandbildern ausgehe. Die Aufgabe der Therapeutin sah sie darin, einen freien und geschützten Raum für die Selbstregulation der Psyche bereitzustellen, die Atmosphäre der Sandbilder in sich aufzunehmen und sich in die Symbole einzufühlen, die von ihr gemäß der Archetypenlehre Jungs gedeutet wurden.
Vor allem angeregt durch Linde von Keyserlingk, langjährige Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Sandspieltherapie, entstanden in der Tradition Kalffs später auch Konzepte für das Sandspiel mit Familien, Paaren und Gruppen. Als Lehrtherapeutin für Familien- und Systemtherapie interessierte sie dabei auch ein systemischer Zugang zu Sandbildern:
»Zurzeit gibt es Überlegungen, dass es doch eine ganz eigene Sprache der Sandspieltherapie geben sollte, die nicht deutet, nicht diskutiert, sondern durch sparsames, amplifizierendes, vielleicht auch zirkuläres Fragen Suchverhalten anregt und neue Denk-Wege [so im Orig.] bahnt« (von Keyserlingk 2011, S. 100).
1 Da Sandspieltherapie von Frauen entwickelt wurde und ich mich in der Darstellung auf meine Erfahrungen beziehe, verwende ich hier die weiblichen, sonst zur besseren Lesbarkeit oft die männlichen Endungen. Gemeint sind jeweils alle Geschlechter.
2 Sandbilder in Bewegung bringen
2.1 Narrative Sandspieltherapie im Einzelsetting
In der klassischen Anwendung der Sandspieltherapie bleiben Sandbilder nach dem Aufbau stehen; gegebenenfalls werden sie noch mit der Therapeutin reflektiert. Narrative Sandspieltherapie unterscheidet sich vor allem darin, dass die Sandbilder im therapeutischen Prozess auch verändert werden können. Sandbilder, zu Beginn einer Therapie gebaut, sind geprägt vom Problemerleben der Kinder und Jugendlichen; viele von ihnen wirken wie eingefroren in einer »Problemtrance« (Schmidt 2004). In Anlehnung an narrative Konzepte (White 1989) rege ich an, solche Bilder »weiterzuspielen« und in eine Geschichte überzuführen. Hypnosystemisch betrachtet, entsteht eine Bewegung von einem Problemzustand zu gewünschtem Erleben.
MARIE, 7 JAHRE alt und wegen zahlreicher Ängste in Therapie2, nähert sich dem Sandkasten sehr vorsichtig. Behutsam stellt sie Prinzessinnen an einen Strand, die sich flüsternd unterhalten; später kommen auch Einhörner dazu. Ein kleines Einhorn entfernt sich von den anderen, um mit einem Pinguin zu spielen. Dabei wird es von einem Sturm weggeweht, steht allein am Meer und hat große Angst. Glücklicherweise wird es von einer Frau gefunden und wieder zu den anderen zurückgebracht. Auch ein Reh verläuft sich im Sturm und geht fast verloren.
Während sich das kleine Einhorn und das Reh noch im Sand ausruhen, fliegt ein Schwan zu den Prinzessinnen, der sich beim Landen einen Flügel bricht. Eine Frau und die Feuerwehr kommen, um dem Schwan zu helfen. Sie umstellen ihn mit einem Kreis von Sperren, damit ihm niemand etwas tun und sein Flügel in Ruhe heilen kann; Kinder helfen mit. Marie erklärt das Sandbild für fertig, sodass ich es auf einem Foto festhalte (Abb. 1).
Abb. 1: Der verletzte Schwan
Die Szene spiegelt Maries Lebenssituation, die nach der Fehlgeburt eines erwarteten Geschwisterchens von Sorgen der Eltern um die Tochter bestimmt ist. Auch von ihr aus ist es zu einer ängstlichen Anbindung an die Eltern gekommen.
Längere Zeit sitzen wir vor dem Sandbild und betrachten es; auch die Prinzessinnen schauen auf den Schwan und scheinen abzuwarten. Schließlich teilt mir Marie mit, dass die Geschichte weitergeht: Kinder bemerken als Erste, dass der Flügel wieder geheilt ist, und sammeln die Sperren ein. Der Schwan freut sich, dass er wieder frei ist und fliegen kann (Abb. 2).
Ein späteres Sandbild Maries thematisiert eine Geburtssituation, die gut endet. Wieder sind Prinzessinnen zusammen am Strand; dort entdecken sie eine Schildkröte, die ein Baby bekommt. Die Mutterschildkröte testet den Panzer der kleinen Schildkröte: Er ist stabil und hält. Einhörner kommen und helfen bei der Geburt, ein Geschenk wird im Sand versteckt.
Abb. 2: Die Sperren werden entfernt
Begleitung des Sandspiels und Entwicklung von Sandbildgeschichten
Einstimmung auf das Sandspiel
In Sandbildern tauchen häufig Themen auf, die dem Alltagsbewusstsein nicht zugänglich sind. Damit Kontakt zu tieferen Ebenen des Erlebens entstehen kann, ist es bei Kindern3 oft wichtig, zunächst das Spielgeschehen zu entschleunigen. Ich teile dem Kind mit, dass man im Sand etwas »bauen« kann, und stelle in Aussicht, ein Foto zu machen, wenn es damit fertig ist. Damit grenze ich das Sandspiel vom beiläufigen Spiel ab, bei dem ein Kind beispielsweise ein Auto durch den Sand fahren lässt und sich danach wieder etwas anderem zuwendet. Ich lasse die unterschiedlichen Qualitäten von nassem und trockenem Sand erkunden, die in zwei Kästen zur Verfügung stehen, und rege an, mit den Händen Kontakt zum Sand aufzunehmen und ihn zu formen, bevor Figuren hineingestellt werden.
Begleitung des Bauens
Um Tranceprozessen beim Gestalten im Sand Raum zu geben, begleite ich das Entstehen der Sandbilder in der Regel schweigend an der Seite des Sandkastens. Können Kinder Stille schlecht aushalten und sprechen selbst unentwegt, spiegele ich den Gestaltungsprozess und erzeuge eine Art Klangteppich, der ihnen Sicherheit gibt (»Dort ist ein Haus, da fließt ein Fluss …«). Beginnen sie zu spielen, erinnere ich an das Foto und frage, ob sie schon fertig sind. Dies verhilft auch sehr flüchtigen Kindern oft zu einem vertieften Bauen. Findet ein Kind bei der Gestaltung kein Ende, orientiere ich es von der Fülle des Materials im Sandspielregal zurück auf sein Sandbild und frage, welche zwei oder drei Dinge noch fehlen, damit das Bild vollständig ist. Ausnahmen mache ich, wenn es für ein Kind nach früher erlebter Vernachlässigung wichtig ist, die eigenen Figuren umfassend zu versorgen.
Betrachtung und Reflexion des Sandbilds
Ist das Sandbild fertiggestellt, wird es auf einem Foto festgehalten. Ich setzte mich neben das Kind und schlage vor, das Gebaute erst einmal gemeinsam anzuschauen. Dabei achte ich auf nonverbale Reaktionen des Kindes und auch auf Impulse, die bei mir durch das Sandbild entstehen. Anschließend lasse ich mir beschreiben, was im Sand geschieht. Während das Kind erzählt, versuche ich, mich im Sandbild zu orientieren und einen möglichen Bezug zu seiner Lebenssituation zu erfassen. Aus konstruktivistischer Perspektive deute ich die verwendeten Symbole nicht; im Gespräch interessiert mich ihre subjektive Bedeutung für das Kind.
Sandbilder