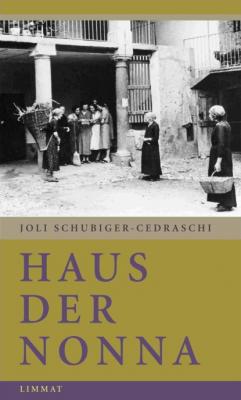ТОП просматриваемых книг сайта:
Haus der Nonna. Joli Schubiger-Cedraschi
Читать онлайн.Название Haus der Nonna
Год выпуска 0
isbn 9783038550563
Автор произведения Joli Schubiger-Cedraschi
Издательство Bookwire
Pá Cesar verkaufte an Martini regelmässig auch die beiden Zugochsen, die er während eines Jahres grossgefüttert hatte, und besorgte sich ein junges Paar. Mit diesen Tieren ging man sehr behutsam um. Man schlug sie nie mit der Peitsche. Damit sie rasch zunahmen, gab man ihnen Fladen aus gepressten Leinsamen, die ein fahrender Leinölhändler anbot. Die Fladen wurden in der Tränke aufgelöst. Wenn die Ochsen am Saufen waren, pfiff einer der Männer ein Lied. Der Brauch, den Appetit der Tiere durch Pfeifen oder Singen anzuregen, soll damals weit verbreitet gewesen sein.
In den zwanziger Jahren kam dann billige Seide aus Japan und China, und die Preise, die die Seidenfabrikanten für Kokons zu zahlen bereit waren, sanken bis auf ein Viertel des früheren Werts. Die Arbeit lohnte sich nicht mehr. Da die Pachtzinsen nicht gleichzeitig auch gesunken waren, mussten sich die Bauern nach einer anderen Nebenbeschäftigung umsehen. Sie fingen an, Tabak zu pflanzen.
Auch hier konnten die Kinder mithelfen. Vor allem das Einfädeln der Blätter auf die Schnüre, an denen man sie zum Trocknen in die Lauben hängte, wurde von Kindern und Frauen besorgt.
An Martini bezahlte man nicht nur die Pachtzinsen. Auch Schulden waren zu begleichen, vor allem in den Läden, wo man während des Jahres alle Einkäufe aufschreiben liess. Die Löhne der Emigranten waren hier unentbehrlich. Manchmal, nach einer Krankheit oder einer schlechten Ernte, fehlte aber das Geld. Ein Ladenbesitzer soll mit der Not solcher Familien ein gutes Geschäft gemacht haben. Er nahm eine Wiese oder einen Rebberg als Pfand. Den Wert des Grundstücks bestimmte er selber. Wurde das Pfand dann nicht eingelöst, was häufig vorkam, ging es in seinen Besitz über. Die Familien verarmten nach und nach, und die Kinder mussten schon mit zehn Jahren bei erfolgreicheren Leuten als Knechte arbeiten.
Bruno, ein Schulfreund meines Vaters, stammt aus einer solchen verschuldeten Familie. Er ist jetzt ein reicher Bauunternehmer. Mit List und Hartnäckigkeit hat er sich das verschafft, was er als Kind entbehrte. Er war einer der Ersten im Dorf, die ein Auto besassen. Der Sohn jenes üblen Ladenbesitzers soll sich sehr darüber gewundert haben. Er fragte Bruno, wie er zu seinem schönen Amerikanerwagen gekommen sei. Und Bruno antwortete vieldeutig: «Ich habe meine Schritte immer nach der Länge meiner Beine gemacht.»
Einer von Brunos Brüdern soll sich von Tag zu Tag mit kleinen Tricks beholfen haben. Er sei beispielsweise, heisst es, in abgelegene Dörfer gegangen und habe dort den Pfarrer aufgesucht. Er komme im Auftrag einer bestimmten Firma, um auf dem Friedhof die Grabsteine und Grabfiguren zu reinigen. Mit einem Stück Schmirgelpapier machte er sich an die Arbeit. Er ass im Pfarrhaus und übernachtete dort. Nach einer Woche bat er den Pfarrer um einen Vorschuss. Und mit diesem Geld soll er am Tag darauf verschwunden sein.
Einige Jahre vor Pá Cesars Tod begann dann die Auflösung der Grossfamilie. Der Hof konnte die wachsende Sippe nicht mehr ernähren. Girumín und seine Frau waren die Ersten, die auszogen. Sie richteten sich in einem benachbarten Hof ein. Später gingen auch die anderen; nur Carlín, der Älteste, blieb. Er besorgte weiter den Stall und die Felder. Alle übrigen Männer arbeiteten nun auswärts und überliessen das Haus und die Landwirtschaft ihren Frauen.
Nonno Pepp und Ziu Girumín kehrten erst im Alter wieder ganz ins Dorf zurück. Sie waren beide gebrechlich und hatten aus der Fremde etwas Heiteres und Weites mitgebracht.
Begrüssungen. Ziu Girumín und Zia Lisa, Ziu Carlín und Zia Maria. Abfahrt des Vaters.
Gegen Abend, noch vor dem Nachtessen, besuchten wir Girumín, Papà und ich. Die Reihe unserer Besuche begann fast immer bei ihm. Er sass beim Feuer, mit dem Rücken gegen das Fenster, wenn wir in die Küche traten. Da das Stehen und Gehen für ihn sehr beschwerlich war, erhob er sich nicht, um uns zu begrüssen. Er freute sich aber, das sah man seinen Augen an. Papà stellte zwei Stühle zum Kamin, und wir setzten uns. Girumín sprach sehr wenig, und das wenige sehr langsam. Er rückte an seiner Schirmmütze und sagte zum Scherz einige Worte auf Zürichdeutsch. Zusammen mit Nonno Pepp hatte er in Zürich gearbeitet. Manchmal zählte er Namen von Strassen und Plätzen auf, die mir halb vertraut waren und die aus seinem Mund sehr fremdländisch tönten: Bellevueplatz, Paradeplatz, Bahnhofstrasse, Limmatquai. Dabei lachte er mich an. Er hatte sein rechtes Bein ausgestreckt und strich mit der Hand darüber hin. Manchmal hielt er auch den Stock, an dem er ging, zwischen den Knien, die Hände über dem gebogenen Griff. Er bot uns Wein an und zeigte dabei auf den Schrank, wo die Flaschen und Gläser standen. Papà goss zwei Gläser voll; ich bekam verdünnten Wein mit etwas Zucker. Das Gespräch verlief dann immer ungefähr gleich. Girumín wollte wissen, wen wir schon besucht hatten und ob wir in Zürich auch Guido, seinen Sohn, hie und da sehen würden, und Papà erkundigte sich nach dem Garten, den Girumín noch besorgte.
Später trat auch Zia Lisa, die uns aus den Reben schon einen Gruss zugeschrien hatte, in die Küche. «Da seid ihr ja», sagte sie und gab uns ihre kleine, raue Hand. Es hiess, sie arbeite wie ein Pferd, und sie sah auch aus wie ein Pferd, vor allem wenn sie, den Kopf vorgebeugt, die Locken wie eine Stirnmähne über den Augen, ihren gelben Leiterwagen hinter sich herzog. Wer dann einen Gruss von ihr wollte, musste sich ihr in den Weg stellen oder sie beinahe anbrüllen.
Jetzt kochte sie Kaffee und lud ein, uns hinüber an den Tisch zu setzen. «Mach doch erst die Stühle frei!», sagte Girumín. Sie räumte die Zeitungen weg. «Hast du nichts für die Jaale?», fragte er dann, und sie suchte im Schrank herum, bis sie schliesslich einen Pfirsich fand, der schon angefault war. Solche Mängel sah sie gar nicht. Wenn Girumín reklamierte, weil ein Glas fettig war oder tote Fliegen sich darin gesammelt hatten, dann schaute sie sich die Sache an, etwas stumpf und verwundert, nicht wie jemand, der kurzsichtig ist, eher wie jemand, der gar nichts sieht.
Ich mochte Zia Lisa sehr gern. Sie wollte nicht so viel von mir wissen, wie Erwachsene sonst von Kindern wissen wollen. Sie war bescheiden. Richetta, ihre Tochter, die im gleichen Haus wohnte, kochte immer so viel, dass es auch für die beiden Alten noch gut gereicht hätte. Doch Zia Lisa nahm kaum etwas an, nicht aus Stolz, sondern weil sie es nicht gewohnt war und es darum nicht brauchte. Milchkaffee mit ein paar Brocken Polenta oder etwas aufgewärmte Minestra genügte den Alten vollauf.
Zia Lisa war die Schwester meiner Grossmutter. Ziu Girumín und Nonno Pepp, die beiden Brüder, hatten zwei Schwestern geheiratet. Was Zia Lisa sagte und unternahm, erinnerte mich denn auch sehr an die Nonna, nur geriet bei Zia Lisa alles noch um eine Spur misstrauischer und eigensinniger.
Ziu Girumín fing an, Reste des Mittagessens auf dem Feuer zu wärmen. Papà sprach mit Zia Lisa, die jetzt auch ein Glas Wein vor sich hatte, über den Tabak, den Mais und die Trauben. Sie klagte über den Regen, der alles ersaufen lasse, oder über den fehlenden Regen oder über den miesen Frühling. Sie klagte immer. Girumín rührte unterdessen in seiner Pfanne.
Dieser Girumín, der wenig und langsam sprach, soll früher ein guter Geschichtenerzähler gewesen sein. Er war ein sehr heiterer Mensch. Mein Vater sagt, er habe Geschichten gewusst, Rittergeschichten vor allem, die so lang waren wie der ganze Winter. Ein Bovo d’Antona kam darin vor und andere Männer mit klingenden Namen. Zur Zeit Pá Cesars soll sich die ganze Familie abends im warmen Stall versammelt haben, um ihm zuzuhören. Vor dem Schlafengehen nahm Pá Cesar dann seinen Hut vom Kopf und sagte: «So, nun erzähle ich meine Geschichte.» Er meinte damit den Rosenkranz. Mein Vater, der damals noch ein kleiner Junge war, versuchte stets, ihm den Hut von hinten wieder aufzusetzen. Manchmal gelang es ihm, das Gebet auf diese Weise noch hinauszuschieben.
Am folgenden Tag besuchten wir Ziu Carlín und Zia Maria. Als ältester Sohn von Pá Cesar hatte Carlín den Hof übernommen. Er starb, als ich etwa sechs Jahre alt war. Ich erinnere mich sehr genau an seinen Kamin: eine riesige Feuerstelle mit Bänken rechts und links wie bei der Nonna. Seine Bänke aber hatten seitliche Abschlüsse, die weit über meinen Kopf hinausreichten. Wie Chorstühle sahen sie aus. Zia Maria sog etwas Schnupftabak aus der Grube hinter dem Daumen, bevor sie uns umarmte. Die Ränder ihrer Nasenlöcher waren vom Schnupfen schwarz. Sie stellte den Wein auf. Sicher sagte sie damals schon: «Quell