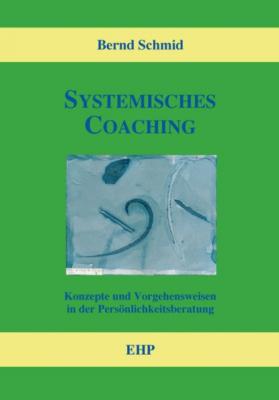ТОП просматриваемых книг сайта:
Systemisches Coaching. Bernd Schmid
Читать онлайн.Название Systemisches Coaching
Год выпуска 0
isbn 9783897975224
Автор произведения Bernd Schmid
Жанр Социология
Издательство Bookwire
1.4.1 Erkennungsmerkmale
Menschen in dieser Dynamik zeigen sich sehr bemüht, das Wohlbefinden anderer sicherzustellen und eine freundliche, niemanden beunruhigende Atmosphäre herzustellen. Allerdings wirkt dies eher als von einer Unsicherheit denn von einer in sich ruhenden Freundlichkeit getrieben. Menschen in der »Sei-gefällig-Dynamik« verwenden oft Redewendungen, die versuchen, die Wünsche und Erwartungen der Gegenüber zu erkunden oder Anpassung daran signalisieren. Nonverbal sind gewohnheitsmäßiges zustimmendes Nicken, gewinnende Gesten und irritierte Blicke, wenn nicht unmittelbar Wirkung erzielt wird, häufig.
1.4.2 Soziale Diagnose
Dieser Antreiber lässt dem Adressaten häufig keinen Spielraum, über Distanz zu entscheiden. Da der »Sei-gefällig-Mensch« Bezogenheit anbietet, aber keine oder fast keine Konturen zeigt, kommt es nicht zu echtem Kontakt. Es bleibt unklar, wo die angebotene Bezogenheit anfängt und wo sie aufhört. In Diskussionen ist es beispielsweise schwer, mit ihnen einen Standpunkt abzugleichen, weil sie unscharf formulieren, Ausflüchte suchen, irgendwie immer alles möglich ist und insgesamt keine eigene Position hindurch zu spüren ist (»Nagel mal einen Pudding an die Wand«).
Gegenüber haben Schwierigkeiten zu orten, wer dieser Mensch ist, der da Bezogenheit anbietet. Da Kontur als mögliche Kontaktfläche fehlt, wird Nähe als unangenehm erlebt. Es können sich auch Phantasien bilden, missbraucht zu werden oder nicht als Person gemeint zu sein (z.B. »Die rückt nicht wirklich damit raus, was sie von mir will«). Meist reagieren Menschen darauf mit Rückzug.
Zur Selbstdiagnose kann die Frage dienen: »Könnte ich »nein« sagen, auch wenn ich »ja« sagen könnte? Wenn »Sei-gefällig-Menschen« beispielsweise gefragt werden, ob Sie Lust haben, in die Kneipe mitzukommen, und nichts im Terminkalender steht, müssen sie »ja« sagen. Oder sie sagen »ja« und merken erst in der Kneipe, dass sie eigentlich hätten »nein« sagen müssen. Auch in beruflichen Rollen zeigt sich die Dynamik oft darin, nicht »nein« sagen zu können.
1.4.3 Emotionale Dynamik, Wirklichkeitslogik und Beziehungsmuster
Das Nicht-OK-Gefühl des »Sei-gefällig-Menschen« hat damit zu tun, in emotionalen Stresssituationen nicht genau zu wissen, wer er ist und was er will. Diese Menschen haben zu wenig Konturen, Selbstvertrauen und (Rollen-)Identität ausgebildet oder halten ihre Konturen für unverträglich mit den Interessen anderer. Eigene Ansprüche und Vorstellungen werden verleugnet oder sind nicht präsent.
Der innere Glaubenssatz bei diesem Antreiber lautet: »Ich kann mich in Beziehungen aufgehoben und wertgeschätzt fühlen, wenn ich mich in andere einfühle.« Die assoziierte Grundannahme lautet: »Ich werde als Individuum nicht geschätzt. Ich habe nur eine Funktion für das Wohlbefinden anderer.« Diese Annahme wird durch eigenes Verhalten und dadurch ausgelöste Reaktionen anderer immer wieder bestärkt. »Sei-gefällig-Menschen« bieten keine Konturen, die das Gegenüber wertschätzen könnte, d.h. die Logik, mit der sie Wertschätzung suchen, hat keine Aussicht auf Erfolg. Sie bieten Gefälligkeit. Wenn sie dazu noch falsche Vorstellungen davon haben, was anderen wirklich gefällt, oder nicht-persönliche Notwendigkeiten der Situation schlecht begreifen, ernten sie leicht Abneigung, ja sogar Verachtung, was ihre Befürchtung, nicht wertgeschätzt zu werden, bestätigt. »Gefällig-Menschen« glauben häufig, keine Identität oder keine Konturen zu besitzen, die interessant sind für andere.
Häufig besteht wirklich ein Nachholbedarf darin zu lernen, wie man eigene Präferenzen und Konturen entwickelt oder in bestimmten Zusammenhängen aktualisiert. Die Anfälligkeit für diese Antreiber-dynamik kann für bestimmte Kontexte, Rollen oder Situationen spezifisch sein. Beruflicher Rollenwechsel (z.B. vom Meister zur Führungskraft) und die damit einhergehende Verunsicherung können dieses Antreiberverhalten auslösen. Menschen orientieren sich dann an ihren Phantasien, was andere wollen, und lassen eigene Konturen vermissen. So sind sie beispielsweise als Abteilungsleiter gefällig und immer um Harmonie bemüht, anstatt zu führen oder Ansprüche zu formulieren.
1.4.4 Antithesen zum »Sei-gefällig-Antreiber«
Die passende Erlaubnis für »Sei-gefällig-Menschen« lautet: »Du darfst dir selbst und anderen gefallen, du darfst eigene Maßstäbe und Konturen zeigen« und »Du darfst dich zumuten«. »Ich und die anderen sind wichtig« statt »Ich bin wichtig, indem ich rauszufinden versuche, was die anderen wollen«. Oft muss auch die Idee redefiniert werden, wie viel Gefallen notwendig ist, um angenommen zu sein. »Sei-gefällig-Menschen« neigen hier zu übertriebenen Erwartungen. Weitere implizite Erlaubnis liegt in der Aufforderung an diese Menschen, zu zeigen, wer sie sind und Identität in einer bestimmten Rolle zu entwickeln, wenn hier Nachholbedarf besteht.
Hierfür können diese Menschen bestärkt werden, zunächst nach eigenen Ansprüchen und Vorstellungen zu suchen und zu lernen, diese auszudrükken, damit andere ihren Gefallen daran prüfen und spezifisch ausdrücken können. Nachdem »Sei-gefällig-Menschen« ohnehin kaum von ihrer Ausrichtung auf Gefallen abzubringen sind, kann man ihnen klar positiv sagen, was gefallen könnte. Ansprüche können bei ihnen zwar zunächst Irritationen auslösen, weil sie unsicher sind, ob sie diese Wünsche bedienen können. Sie haben dann aber die Sicherheit zu wissen, wie sie gefallen können. Das Bedürfnis, gefällig zu sein, wird genutzt, um ihnen zu helfen, eigene Konturen auszubilden. So kann beispielsweise einer Führungskraft im Coaching Anweisung gegeben werden, wie sie eigene Zielvorstellungen gegenüber Mitarbeitern vertreten und umsetzen kann. Diese Art eines rollenspezifischen Umgangs führt zu einer deutlichen Abschwächung der Antreiber-dynamik innerhalb der Rolle. Zudem sind Streueffekte in andere Lebensbereiche zu erwarten. Konkrete Rollenanweisungen zu geben bedeutet eine effektive und schlanke Strategie im Umgang mit dem »Seigefällig-Antreiber«.
Eine Gefahr der »Sei-gefällig-Dynamik« findet sich im Kippen von einer übermäßigen Rücksicht in eine übermäßige Rücksichtslosigkeit. Diese Menschen halten ihre Interessen oft übermäßig zurück, um diese Zurückhaltung irgendwann als Rabattmarke auszuzahlen. Es besteht die Gefahr, dass dann die Schattenseite des freundlichen Entgegenkommens gelebt wird. Die Lösung für eine Polarisierung von Fremd- und Eigeninter-esse liegt in einer ausgeglichenen Kombination von Selbstbeachtung und Entgegenkommen. Wichtig ist daher, diese Menschen dazu einzuladen, auf sich und auf andere Rücksicht zu nehmen.
Bei der Entwicklung des »Sei-gefällig-Menschen« hin zur Verwirklichung eigener Ansprüche muss unter Umständen auch mit Missfallen der Umwelt gerechnet werden. Diese hat zum Teil die Gefälligkeit als durch -aus bequem erlebt und ist über das plötzliche Auftreten eigener Ansprüche des »Sei-gefällig-Menschen« nicht unbedingt erfreut. Im Coaching ist es daher um so wichtiger, systemseitige Rahmenbedingungen mitzubedenken.
1.4.5 Ressourcen des »Sei-gefällig-Antreibers«
Die Tugend des »Sei-gefällig-Menschen« ist seine soziale Wahrnehmung, die ihm ermöglicht, auf die Bedürfnisse anderer im Prozess einzugehen. Er kann sehr sensibel für Gruppenprozesse, soziale Stimmungen und Reaktionen sein. Diese Fähigkeit erleichtert ihm, sich an andere Menschen und Systeme anzukoppeln. Wichtig ist, dass er die Außenwelt auf seine eigene Welt bezieht, sie dadurch relativiert und als Information nutzen kann, damit sie nicht reflexhaft seine Steuerung beeinflusst.
1.4.6 Konterdynamik: »Besser garstig als ein Niemand!«
Menschen mit der »Sei-gefällig-Dynamik« können sich ins Gegenteil flüchten und trotzig Nichtgefallen provozieren. Mit der gleichen Mentalität und dem gleichen Eifer, aber mit verkehrten Vorzeichen wird Missfallen erweckt. Für das Aufgeben des Versuches zu gefallen, wird der scheinbare Gewinn gesucht, wenigstens Täter und nicht Opfer zu sein und so dem enttäuschten Trotz und rachsüchtiger Verachtung Ausdruck zu geben. All dies kann sehr diskret und unterschwellig mitschwingen.
1.5 Antreiber 4: »Ich bin OK, wenn ich mich anstrenge!«
1.5.1 Erkennungsmerkmale
Wenn