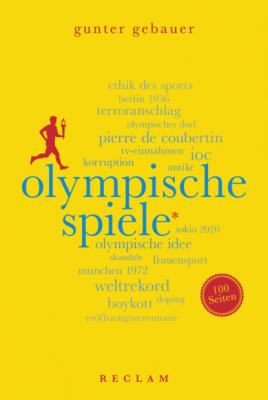ТОП просматриваемых книг сайта:
Olympische Spiele. 100 Seiten. Gunter Gebauer
Читать онлайн.Название Olympische Spiele. 100 Seiten
Год выпуска 0
isbn 9783159616858
Автор произведения Gunter Gebauer
Серия Reclam 100 Seiten
Издательство Bookwire
Gunter Gebauer
Olympische Spiele. 100 Seiten
Reclam
Für mehr Informationen zur 100-Seiten-Reihe:
2020 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung nach einem Konzept von zero-media.net
Infografik: annodare GmbH, Agentur für Marketing
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2020
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961685-8
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020558-7
Rom 1960, vor dem Fernseher – als wir alles noch vor uns hatten
Das Wohnzimmer meiner Eltern war abgedunkelt, wegen der Sonne. Die meisten von uns saßen in der Polsterecke, andere wie ich auf Stühlen um den Tisch herum, mein jüngerer Bruder Heiko hockte mit seinen Freunden auf dem Teppichboden. Die ganze Leichtathletik-Trainingsgruppe war da; wir waren B-Jugend, 15 bis 16 Jahre. Dieter war gekommen – er war Trainer, wusste alles über den olympischen Sport und studierte an der Kieler Universität. Mein Vater war gegen das Fernsehen. Vor den Olympischen Spielen 1960 ging er los und kaufte ein großes Standgerät mit abschließbaren Türen. Der Fernseher sollte nur zu den Spielen angestellt werden. Im Spätsommer hatten wir fast täglich auf dem Holsteinplatz trainiert; dabei war die Saison für uns schon vorbei. Wir trainierten für Rom, nach dem Training fuhren wir mit dem Rad zu uns nach Hause, zum Fernsehen: olympische Leichtathletik.
Einige der Stars hatten wir schon einmal aus der Ferne gesehen, bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in der Kieler Ostseehalle. Armin Hary, er wirkte merkwürdig nervös, aber er hatte im selben Jahr einen neuen Weltrekord über 100 m aufgestellt. Jetzt kniete er im Olympiastadion von Rom in den Startblöcken: das Finale. Dieter sagte: »Hary hat nur eine Chance gegen die Amis, wenn er einen Blitzstart erwischt«. Hary schoss aus den Blöcken, aber es war ein Fehlstart. Im Wohnzimmer machte sich Unruhe breit. »Hary hat starke Nerven«, das war mein Vater, der von der Arbeit gekommen war und sich schnell zwischen uns setzte. Und seine Worte hatten Gewicht. Mein Vater war Starter für den Leichtathletikverband. Er hatte Hary seinerzeit in der Kieler Ostseehalle gestartet. Es stimmte, Hary war auch beim zweiten Mal vorn, aber kurz vor dem Ziel schoss Dave Sime aus den USA an ihn heran und warf sich im Hechtsprung über die Ziellinie. Mit dem Kopf war er als Erster im Ziel. Aber Kopf zählte nicht, nur der Rumpf. Wir warteten auf das Zielfoto. Es musste erst entwickelt werden. Im Raum wurde die Luft immer dicker, die Pessimisten tönten schon: »Bestimmt gewinnt wieder ein Ami.« Dann die Anzeigetafel, der erste Name erschien, es war Hary. Damals fiel man sich noch nicht in die Arme; ich weiß nicht, was wir getan haben, um unsere Freude auszudrücken. Wahrscheinlich haben wir auf den Tisch gehauen oder auf den Teppichboden oder auf dem Rücken des Nebenmannes herumgetrommelt. Meine Mutter rannte in die Küche und kam mit Schnittchen zurück. Wir feierten mit Apfelsaft.
100-m-Finale, Rom 1960. Links außen: Armin Hary (BRD). Rechts außen wirft sich Dave Sime (USA) über die Ziellinie.
Am nächsten Tag war Weitsprung dran: »Steinbach sieht gut aus«, ich kommentierte (denn ich war Weitspringer). Dr. Steinbach sprang mit genau 8 m einen neuen deutschen Rekord, 10 cm weiter als Luz Long, der 1936 mit Jesse Owens im Gras lag (Reemtsma Olympia-Album) und erreichte Platz vier des Wettkampfs. Der 400-m-Lauf wurde wieder nervenzerfetzend. Das Finale hatte Charly Kaufmann nach unserem Urteil gewonnen, er lief tatsächlich Weltrekord, das Kampfgericht sah ihn zeitgleich mit Otis Davis, aus den USA, aber 1 cm hinter ihm. Die Amis verloren dann doch noch einmal gegen die Deutschen, ausgerechnet in der 4-×-100-m-Staffel; sie waren zwar schneller, wurden aber wegen eines Wechselfehlers disqualifiziert.
»Jetzt aber konzentrieren, Jungs«, Dieters mahnende Stimme. Wir hatten noch gar nicht bemerkt, dass das Fernsehen an einen anderen Olympia-Ort umgeschaltet hatte. Jetzt schauten wir von oben auf den Albaner See hinunter. Dort machten sich die Ruderer startbereit: das Achterrennen. Unser Achter, Studenten von der Kieler Uni mit ihrem Ratzeburger Trainer, dem Physiklehrer Karl Adam. Wieder Dieter: »Der ganz vorn im Boot ist mein Freund Hans Lenk. Gebt euch Mühe!« Das war ja klar, der Stolz unseres Bundeslands! Das Boot führte. Es hatte noch nicht gewonnen, als sich ein anderer Achter heranschob, aber mit unserer Anfeuerung schaffte es unser Boot als erstes über die Ziellinie.
Es war eine offene Welt, die sich in diesen Tagen vor uns auftat. Damals sahen wir nur den unverdorbenen Kern der Spiele. Doch meine unbekümmerte Haltung zum Sport wurde erschüttert, als ich einige Jahre später Mitglied eines erfolgreichen Sportclubs wurde. Hinter vorgehaltener Hand wurde von Doping gesprochen, von kleinen blauen Pillen. Gesehen hatte ich sie noch nicht. Ich hatte aber erstaunliche Veränderungen an den Körpern einiger Athleten wahrgenommen, die ich gut kannte. Ihre in kurzer Zeit gewonnene Muskelmasse entsprach der rasanten Verbesserung ihrer sportlichen Leistungen. Einer aus unserer Kieler Trainingsgruppe gewann mit 19 Jahren in Tokio 1964 die Bronzemedaille im Hammerwerfen, einige Jahre später den Weltmeistertitel. Ein anderer befreundeter Athlet stellte 1967 einen Weltrekord im Zehnkampf der Männer auf; bei den Spielen von 1968 in Mexico City gewann er die Bronzemedaille. Wir hatten uns in der Jugendklasse einige Male duelliert; nun hatte er sich die ausgeprägteste Muskulatur zugelegt, die ich je gesehen hatte.
Zu jener Zeit war das Bewusstsein, dass Doping Betrug war, noch deutlich unterentwickelt. Während meines Studiums in Mainz versprach mir ein freundlicher, mir allerdings unbekannter Herr nach einigen guten Wettkampfergebnissen (1965), eine große Zukunft im Weitsprung. Ich wusste nicht, was er mit mir vorhatte, war aber darauf gespannt. Prof. Berno Wischmann, der Direktor des Sportinstituts, war wachsam. Er bestellte mich ein, ließ ein Donnerwetter auf mich los und klärte mich über Doping auf. Für mich löste sich der Zauber Olympias auf. Mein Interesse am sportlichen Wettkampf begann gegenüber meinem Interesse an Philosophie und Literaturwissenschaft in den Hintergrund zu treten. Was mich nun faszinierte, war die strukturelle Ähnlichkeit des sportlichen Wettkampfs mit dem antiken Drama. Dieses Interesse zog sich durch viele meiner späteren Arbeiten. Ihr Ausgangspunkt sollten die antiken Olympischen Spiele werden. Daher beginnt auch meine Darstellung in diesem Band mit der griechischen Antike.
Mein Mentor wurde in Berlin (ab 1966) Hans Lenk, der Olympiasieger von 1960, inzwischen Privatdozent, später Professor für Philosophie. Unsere philosophischen Schwerpunkte lagen in verschiedenen Feldern, in unseren Gesprächen kamen wir aber immer wieder auf den modernen Sport zurück. Lenk hatte gleich nach seinem Olympiasieg eine Dissertation über die ethischen und sozialen Ziele des modernen Olympismus und seine aktuelle Wirklichkeit geschrieben. Mit dem Abstand zu 1960 und den inzwischen eingetretenen Veränderungen der Olympischen Spiele entwickelten wir eine kritische Sichtweise – eine Kritik, die herausstellen sollte, was diese Spiele für die Moderne (immer noch) leisten könnten. Eine Gelegenheit, dies zu prüfen, war der internationale Wissenschaftskongress unmittelbar vor den Spielen von München 1972; ich war an seiner Organisation beteiligt. Hier wurde der Versuch gemacht, die idealisierende Sicht der Gründergeneration ernsthaft und engagiert zu aktualisieren. Dieser Einsatz war in erster Linie Willi Daume, dem Organisator der Spiele, zu verdanken, der sich unermüdlich mit allen Mitteln und Beziehungen, über die er verfügte, für den Wissenschaftskongress einsetzte und uns persönlich unterstützte.
Aus den Impulsen für die weitere Entwicklung der Olympischen Spiele wurde nichts. Der terroristische Anschlag erstickte die erhoffte Wirkung des Münchner Kongresses für zukünftige Spiele. Der zweite Grund waren die Organisatoren der nächsten Spiele 1976. In Montreal wurden die olympischen