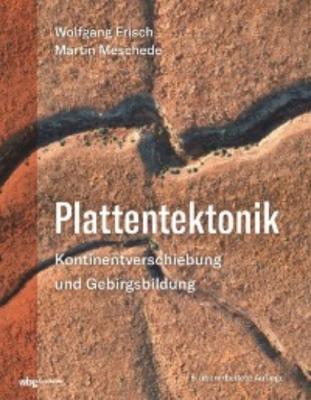ТОП просматриваемых книг сайта:
Plattentektonik. Wolfgang Frisch
Читать онлайн.Название Plattentektonik
Год выпуска 0
isbn 9783534746354
Автор произведения Wolfgang Frisch
Жанр География
Издательство Автор
In Gräben kann auch das Meer eingreifen. Marine Sedimente von Gräben sind meist Tonsteine, Mergel (Ton-Kalk-Gemenge) oder Kalksteine. Hohe Verdunstung von teilweise oder vollständig abgeschnürten Meerwasserbecken in ariden Klimaten führt zur Salzkonzentration im Wasser und schließlich zur Salzausfällung. Salzlagerstätten treten daher oft in Schichtfolgen von Gräben auf und zeigen, wie im Oberrheingraben, marine Ingressionen an. Wenn sich ein Graben zu einem schmalen Ozean entwickelt, wie dies beim Roten Meer der Fall ist, dann markieren Salzlagerstätten die Basis der marinen Schichtfolge.
Abb. 3.4: a) Symmetrisches und b) asymmetrisches Modell für die Entstehung eines Grabenbruchs. Als „Moho“ (Moho rovic ˇi´c-Fläche) wird die Grenzfläche zwischen Kruste und Mantel bezeichnet.
Weitere wichtige Lagerstätten in kontinentalen Gräben stellen Erdöl- und Erdgasvorkommen dar. Die behinderte Wasserzirkulation in einem schmalen Graben meer führt dazu, dass am Meeresboden durch die Bodenbewohner der freie Sauerstoff weitgehend oder vollständig verbraucht wird. In der Sedimentsäule fehlt dann der Sauerstoff zur Verwesung und vollständigen Zersetzung der abgestorbenen Organismen. Es kommt zur Anreicherung von organischer Substanz in den Sedimenten, die dadurch eine dunkelgraue oder schwarze Farbe erhalten. Durch Versenkung dieser Faulschlämme infolge von Überlagerung durch jüngere Sedimente gelangen sie schließlich in das sogenannte Erdölfenster, einen Temperaturbereich zwischen etwa 80 und 170 °C, in dem sich über komplizierte Reaktionsreihen Erdöl aus der organischen Substanz bildet. Bei Temperaturen über ca. 150 °C bilden sich Gaslagerstätten. Ein Beispiel für Faulschlamm-Sedimente, die in einem abgeschnürten Becken entstanden sind, bieten die Ölschiefer von Messel, die im Eozän am Rand des sich einsenkenden Oberrheingrabens in einem Maar-Trichter (einer vulkanischen Durchschlagsröhre) entstanden sind. Durch die Versiegelung durch überlagernde Sedimente des Maarsees wurde das Schichtpaket vor der Erosion bewahrt. In den Faulschlämmen blieben Fossilien sehr gut erhalten. Die Fossil-Lagerstätte von Messel stellt heute ein einzigartiges Denkmal von weltweiter Bedeutung für die Erforschung des Lebens im Eozän dar.
Vulkanismus in Gräben
Die magmatischen Gesteine, die sich in Grabenbruchsystemen bilden, sind typischerweise alkalisch, d. h., sie weisen einen Überschuss an Alkalien (Na2O, K2O) relativ zum Kieselsäuregehalt (SiO2) oder Tonerdegehalt (Al2O3) auf. Oft sagt man auch nur, dass sie an Kieselsäure (gegenüber Alkalien) untersättigt sind, was für die meisten, aber nicht für alle alkalischen Gesteine zutrifft. Alkalischer Charakter ist typisch für Magmen, die primär durch geringe Schmelzanteile im Erdmantel entstehen (siehe Kap. 6, 7). Teilweise treten in Grabenbruchsystemen aber auch tholeiit-basaltische Magmen auf, die auf größere Schmelzanteile im Mantel zurückgehen. Dies ist dann der Fall, wenn die Dehnung der Lithosphäre besonders groß ist oder Heiße Flecken ein Rift markieren und dadurch Aufstieg und Aufschmelzung der Mantelgesteine erhöht werden (Kap. 6). Vermutlich entstehen alkalische Basalte durch Teilschmelzung von weniger als 10 % im lithosphärischen Mantel [Wilson 1989]. Tholeiitische Basalte hingegen werden durch stärkere Aufschmelzung (meist über 15 %) aus der Asthenosphäre gewonnen, der auch die tholeiitischen Basalte der Mittelozeanischen Rücken entstammen (Kap. 5). Bei starker Dehnung der Lithosphäre, die mit verstärktem Aufstieg von Asthenosphärenmaterial und größeren Schmelzbildungen einhergeht, gewinnen daher die tholeiitischen Basalte immer mehr an Bedeutung. Die verschiedenen Basalte unterscheiden sich vor allem in ihrem Chemismus, worauf in Kapitel 5 näher eingegangen wird.
In einigen Grabenbrüchen (z. B. den ostafrikanischen Gräben oder dem Rio-Grande-Rift) nimmt die Alkalinität der Gesteinsschmelzen von der Grabenachse zu den Rändern hin zu. Dies deutet darauf hin, dass die Schmelzbildung unter der Grabenachse am stärksten ist. Andere Grabenbruchsysteme zeigen eine Abnahme der Alkalinität mit der Zeit (Kenia-Graben und der permische Oslo-Graben). Dies zeigt zunehmende Dehnung und Schmelzbildung während der Entwicklung des Grabenbruchsystems an. Im Ostafrikanischen Grabenbruchsystem beobachtet man zudem einen Umschlag von alkalischen Basalten in Kenia zu tholeiitischen Basalten in Äthiopien. Die Dehnungsrate nimmt hier von Süden nach Norden deutlich zu (siehe unten).
Abb. 3.5: Das europäische Grabenbruchsystem vom Rhônegraben über den Bresse- und Oberrheingraben bis in die Niederrheinische Bucht.
Der Vulkanismus von Grabenbrüchen ist häufig bimodal. Im nördlichen Rio-Grande-Rift treten tholeiitische Basalte (basisch, SiO2-Gehalt um 50 Gewichts-%) neben Rhyolithen (sauer, SiO2-Gehalt um 70 %) auf. Intermediäre Gesteine mit zwischenliegenden SiO2-Gehalten fehlen hingegen, was nicht mit einfacher Differentiation (Veränderung vor allem durch Ausscheiden früher Kristalle und Abpressen der Restschmelze) aus einem basaltischen Stamm-Magma erklärbar ist. Im Ostafrikanischen Rift herrschen Alkalibasalte (SiO2-Gehalte unter 50 %) sowie Phonolithe (um 55 % SiO2, aber sehr hohe Gehalte an Alkalien: Na2O und K2O zusammen ca. 12 – 14 %) und Trachyte (um 65 % SiO2, Alkalien ca. 10 – 12 %) vor. Die Phonolithe entstehen durch Differentiation aus Alkalibasalten, die an Kieselsäure deutlich untersättigt sind, Trachyte hingegen aus weniger stark untersättigten Alkalibasalten. In Rifts treten auch Karbonatite auf. Das sind magmatische Karbonatgesteine, die aus Calcit oder Dolomit zusammengesetzt sind, aus dem Erdmantel stammen und extrem niedrige Kieselsäuregehalte von wenigen Prozent aufweisen.
Die Bildung der Basaltmagmen erfolgt im Mantel, während die sauren Magmen krustaler Herkunft oder von der Kruste stark beeinflusste Mantelschmelzen sind. Je höher die magmatische Aktivität ist, desto mehr saure Magmen treten auf, die Verteilung wird bimodal. Dies zeigt die Bedeutung von Krustenschmelzen, die durch das Eindringen der viel heißeren Mantelschmelzen erzeugt werden. Grabenbrüche mit geringer Magmaproduktion weisen wenig Dehnung auf, sind durch unterbrochene vulkanische Tätigkeit gekennzeichnet und produzieren oft stark Kieselsäure-untersättigte alkalische Basalte und intermediäre, aber wenig saure Gesteine.
Der Oberrheingraben – klassisches Beispiel vor der Haustüre
Der Oberrheingraben ist zwar nicht einer der größten und schon gar nicht einer der aktivsten Grabenbrüche, doch er ist zusammen mit dem Ostafrikanischen Grabenbruchsystem eine Art Typlokalität für Gräben. Nachdem schon thüringische Bergleute den Begriff „Graben“ für Schollen verwendeten, die an Störungen abgesenkt wurden, führte ihn Johann Ludwig Jordan [1803] in die geologische Literatur ein. Bereits 1841 stellte Élie de Beaumont fest, dass Vogesen und Schwarzwald eine breite Aufwölbung bilden, in deren Zentrum die Oberrhein-Ebene an zwei gegeneinander einfallenden Störungen eingesenkt ist. Endgültigen Eingang in die Fachliteratur und weltweite Anwendung fand der Begriff „Graben“ mit dem Standardwerk „Das Antlitz der Erde“ von Eduard Suess [1885 – 1909]. Seither wurde dieser deutsche Ausdruck auch in die internationale Fachsprache übernommen. Er ist ein definierter Fachausdruck für die lang gestreckten Dehnungszonen in der Erdkruste und darf daher keinesfalls für die Tiefseerinnen an destruktiven Plattengrenzen verwendet werden. Der veraltete Begriff „Tiefseegraben“ entstammt